Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet nicht nur voran, sondern ist auch unbedingt notwendig, um Versorgung zukünftig zu sichern. Besonders im Bereich der medizinischen Dokumentation gewinnen innovative Technologien wie medizinische Spracherkennung zunehmend an Bedeutung – aber warum?
Die Dokumentation von Therapien und Behandlungsentscheidungen stellen eine wesentliche Grundlage für eine umfassende Datenbasis im Gesundheitswesen dar. Gerade im Hinblick auf den künftigen Einsatz von KI wird eine umfassende Datengrundlage Voraussetzung für verlässliche Systeme. Doch gleichzeitig zum technologischen Fortschritt schreitet auch der Fachkräftemangel voran. Es bleibt also immer weniger Personal immer weniger Zeit – für Behandlung und Dokumentation. Hier gilt es als Softwarehersteller die zu unterstützen.
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie welche Trends im Bereich Spracherkennung jetzt wichtig werden und welche Faktoren Sie bei Ihrer Entscheidung für eine Lösung berücksichtigen sollten.
Wohin geht die Reise? Trends in der medizinischen Spracherkennungssoftware

Ein wesentlicher Trend für 2025 ist die zunehmende Nutzung von Cloud-basierten Spracherkennungslösungen, die einerseits standortunabhängige Nutzung und andererseits flexible Skalierbarkeit ermöglichen. Gleichzeitig bleibt das Thema Datenschutz und Datensicherheit zentral, weshalb On-Prem-Lösungen wie SpeaKING weiterhin stark nachgefragt werden.

Als zweiter bedeutender Trend ist der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu nennen, die die Erkennungsgenauigkeit kontinuierlich verbessern. So ist es möglich, auch komplexe medizinische Fachbegriffe und individuelle Sprechweisen zuverlässig zu erfassen. Das unterstützt insbesondere Fachpersonen mit starkem Akzent oder Dialekt. Moderne Systeme lernen dabei fortlaufend aus Nutzereingaben und passen sich an spezifische Anforderungen verschiedener medizinischer Fachrichtungen an.

Zudem gewinnt die Integration von medizinischer Spracherkennungssoftware in bestehende Krankenhausinformationssysteme (KIS) und elektronische Patientenakten (ePA) an Bedeutung. Diese nahtlose Einbindung sorgt für effizientere Workflows und reduziert Medienbrüche, wodurch der Dokumentationsaufwand für das medizinische Personal weiter sinkt.

Ein weiteres zentrales Thema bleibt die regulatorische Entwicklung. In Deutschland und der EU müssen Spracherkennungslösungen strenge Datenschutz- und Compliance-Anforderungen erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die DSGVO und branchenspezifische Vorgaben. Cloud-Lösungen setzen daher zunehmend auf zertifizierte Rechenzentren und Verschlüsselungstechnologien, während On-Prem-Systeme weiterhin für Einrichtungen attraktiv sind, die maximale Datenhoheit und Kontrolle wünschen.
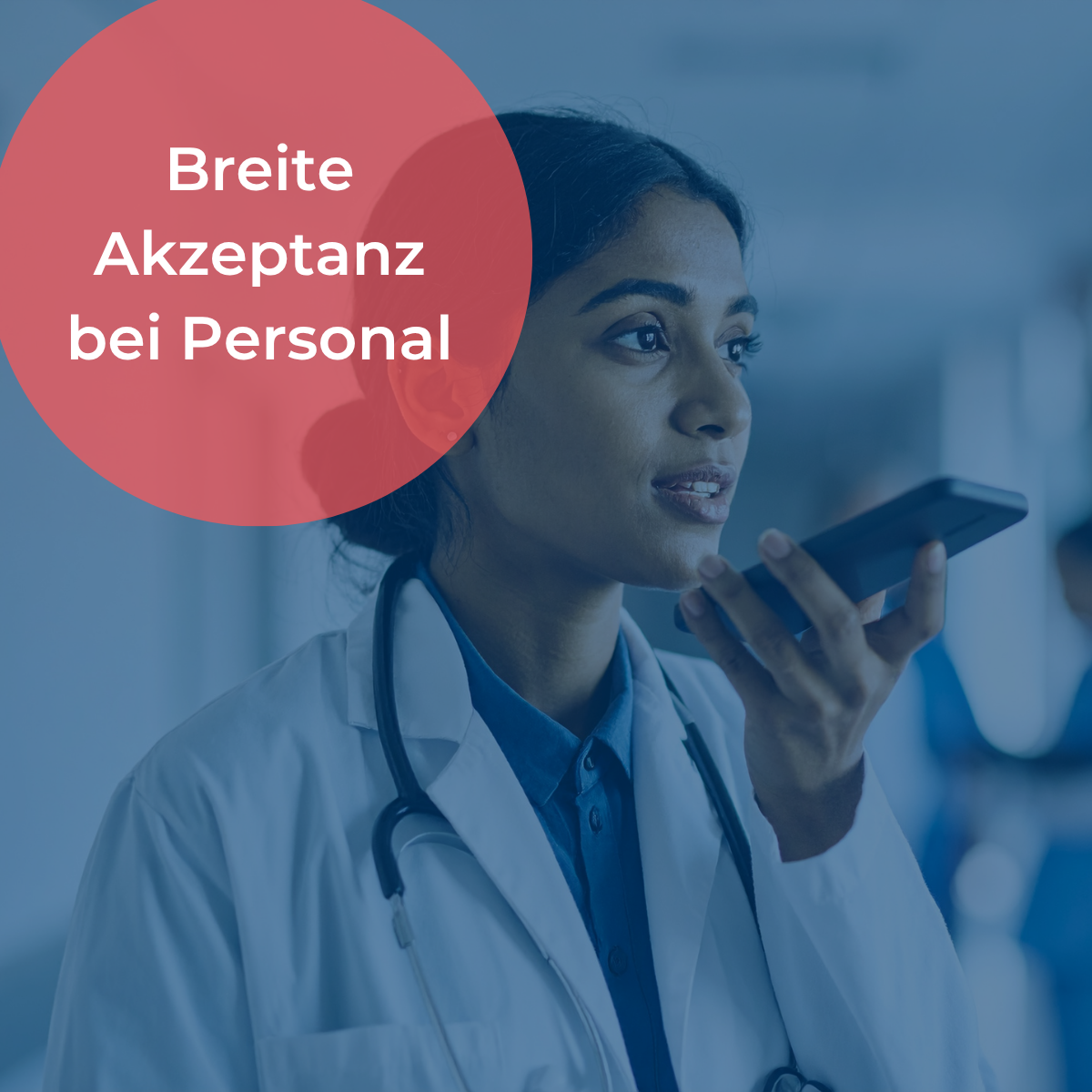
Nicht zuletzt zeigen aktuelle Marktanalysen, dass die Akzeptanz von Spracherkennungssoftware in Kliniken und Praxen weiter steigt. Die Anwendungen werden zunehmend als Standardwerkzeug angesehen, das einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung und Entlastung des Gesundheitspersonals leistet. Dabei bietet der Einsatz von Spracherkennung eine fundierte Option, die Arbeitsumgebung für medizinisches Personal moderner, effizienter und dadurch attraktiver zu gestalten.
Wichtige Aspekte bei der Entscheidung für medizinische Spracherkennungssoftware: Das sollten Sie beachten
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen stellt Klinik-IT-Abteilungen vor die Herausforderung, effiziente, sichere und nachhaltige Systeme für die medizinische Dokumentation bereitzustellen. Spracherkennungssoftware spielt dabei eine immer zentralere Rolle, da sie Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte spürbar bei der Dokumentation entlastet und Prozesse beschleunigt. Welche Faktoren sind dabei jedoch aus Sicht der IT noch entscheidend?
Integration in bestehende IT-Landschaften
Nahtlose Einbindung in KIS, ePA, PACS und weitere klinische Systeme ist essenziell, um Mehrfacheingaben zu vermeiden und einen durchgängigen Datenaustausch zu ermöglichen. Wichtig sind Standardschnittstellen wie HL7, FHIR und REST, um Interoperabilität sicherzustellen.
Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen (z.B. Office, E-Mail, KIS) sollte ebenfalls gegeben sein. Inkompatibilitäten mit gängigen und etablierten IT-Anwendungen sind ein mögliches Ausschlusskriterium.
Präzision und medizinischer Wortschatz
Hohe Erkennungsrate (idealerweise ≥99%) auch bei Fachvokabular, Akzenten und Hintergrundgeräuschen ist ein zentrales Kriterium, das die Nutzerakzeptanz und damit Kosteneffizienz. Die Spracherkennungssoftware sollte außerdem individualisierbare Fachwortschätze, Textbausteine und Unterstützung mehrerer Sprachen bieten.
Datenschutz, Datensicherheit und Compliance
DSGVO-Konformität: Datenverarbeitung und -speicherung müssen höchsten Datenschutzanforderungen entsprechen. On-Prem- und Cloud-Lösungen sollten sich an geltende Vorgaben halten, Hosting idealerweise in Deutschland oder der EU.
Die technische Maßnahmen umfassen zertifizierte Rechenzentren, Verschlüsselung (mindestens AES-256), rollenbasierte Zugriffskontrollen und Lizenzmanagement.
Bedienkomfort und Nutzerzentrierung
Intuitive Oberflächen und mobile Unterstützung auf iOS/Android fördern die Nutzerakzeptanz und tragen zur Effizienzsteigerung bei. Weitere wichtige Voraussetzung ist die einfache Individualisierung, das Anlegen persönlicher Wortschätze und flexible Sprachprofile. Anwender und Anwenderinnen schätzen zudem ein modernes User-Interface, schnelle Reaktionszeiten und die Integration von Sprachkommandos (z.B. Navigation, Formatierung).
Hosting-Optionen und technische Infrastruktur
Häufig besteht die Wahl zwischen Cloud-Hosting (flexibel, skalierbar, ortsunabhängig) und lokaler On-Prem Installation (maximale Kontrolle, ggf. eigene Hardware) – hier hängt die Entscheidung von Datenschutzanforderung und der IT-Strategie der Klinik oder Einrichtung ab. Mobile Spracherkennung und Nutzung auf verschiedenen Endgeräten sollte optional für den Klinikbetrieb verfügbar sein.
Wirtschaftlichkeit
Klar kalkulierbare Lizenz- und Betriebskosten (Nutzerlizenzen, Updates, Schulungen) sind ein wichtiger Faktor für die interne Kostenplanung. Die Kosteneffizienz der Anschaffung wird zudem durch hohe Nutzerakzeptanz und Nutzungsdichte positiv beeinflusst.
Künstliche Intelligenz und Zukunftsfähigkeit
Moderne Lösungen setzen auf KI und maschinelles Lernen, um die Erkennungsgenauigkeit kontinuierlich zu verbessern und sich an individuelle Sprechweisen anzupassen. Sie bieten zudem die Möglichkeit, weitere KI-basierte-Features zeitnah umzusetzen bzw. zu nutzen.
Fazit: IT-Strategie und Anforderungen definieren, dann Anbieter vergleichen
Eine zukunftssichere Entscheidung für Spracherkennungssoftware aus Sicht der Klinik-IT umfasst technische Integration, Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität sowie klare Kostenstruktur und zuverlässigen Support. Lösungen punkten mit individueller Anpassbarkeit, KI-Integration sowie geprüften Sicherheitsmechanismen – und bieten damit echte Mehrwerte im klinischen Alltag.
Tipp: Klinik-IT-Verantwortliche sollten die individuellen Anforderungen ihrer Einrichtung systematisch prüfen und Anbieter anhand klar definierter Kriterien (Integration, Sicherheit, Support, Flexibilität) vergleichen, um so die nachhaltigste Lösung für den medizinischen Alltag zu wählen.
Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?
Schreiben Sie uns gern – wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Entdecken Sie unsere Lösungen für medizinische Spracherkennung – ob Cloud oder On-Prem, wir beraten Sie gern zu Ihrem Use Case!

Nutzen Sie ganz einfach unsere Cloud Lösung für Spracherkennung in Ihrer Windows-Umgebung, im KIS und andere wichtige Anwendungen wie Office-Tools!
Wechseln Sie flexibel zwischen digitalem Diktat und Spracherkennung bei lokalem Hosting mit SpeaKING!

